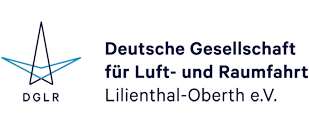DGLR-Publikationsdatenbank - Detailansicht
Titel (EN):
Methods and Technologies for Combined Hydrogen-SAF-Operation of Regional and Business Jet Aircraft
Autor(en):
C. Clemen, R. Eggels, T. Dörr
Zusammenfassung:
Bei der Dekarbonisierung der Luftfahrt spielt Wasserstoff eine zentrale Rolle als potenziell vollständig CO2 freie Alternative zu Sustainable Aviation Fuels (SAF). Vor der Einführung von Wasserstoff in den Markt, sind jedoch zahlreiche technische, logistische und kommerzielle Herausforderungen zu meistern. In den letzten drei Jahren ist es bereits gelungen, einige der technischen Herausforderungen, wie zum Beispiel eine sichere und saubere Direkt-Verbrennung des Wasserstoffs in einer Fluggasturbine erfolgreich zu lösen [1 - 4]. Jedoch ist insbesondere die Integration einer Flüssig-Wasserstoffversorgung in das Triebwerk beziehungsweise die Flugzeugzelle noch nicht auf einem akzeptablen Technologieniveau angekommen, so sind zum Beispiel die erforderlichen Pumpen noch nicht ausgereift. Darüber hinaus ist die sichere Handhabung des flüssigen Wasserstoffs im Flugzeug, aber insbesondere am Flughafen noch nicht etabliert. Auch die erforderliche Infrastruktur, die weltweit für eine Versorgung der Flughäfen in den benötigten Mengen erforderlich ist, wird nicht flächendeckend zur Verfügung stehen, wenn das erste wasserstoffbetriebene Flugzeug marktreif sein wird. Daher stellt sich die Frage, welches Modell kommerziell sinnvoll ist, um Wasserstoff in die Luftfahrt einzuführen. Basierend auf den zuvor benannten Herausforderungen kann es daher sinnvoll sein, Flugzeuge für den Kurzstreckenbetrieb mit Wasserstoff anzutreiben. wobei der Wasserstoff dann gasförmig im Flugzeug gelagert werden kann. Für die Mittel- und Langstrecke wird wiederum auf Sustainable Aviation Fuel (SAF) zurückgegriffen. Ein Business Case wird aber nur dadurch entstehen, wenn eine entsprechende Anzahl von Flugzeugen an den Markt gebracht werden kann. Daher würde es Sinn machen, insbesondere im Geschäftsreise- oder auch Regionalflugzeug-Markt Produkte zu etablieren, die mit beiden Kraftstoffen betrieben werden können, da diese häufig nur kurze Strecken bis 1000Nm bedienen, aber dem Kunden dennoch auch 4000 oder mehr nautische Meilen Reichweite anbieten müssen. Dies ist dann der sogenannte „Dual Fuel“ Betrieb. Dieses Konzept wird von Rolls-Royce in den Forschungsprojekten Cavendish (EU Clean Aviation) und Wotan (Lufo 6, FKZ 20M2104A) sowie Bretuflex (Lufo 6, FKZ 20M2237H) untersucht. In diesem Paper werden die für den "Dual Fuel" Betrieb notwendigen operationellen und technischen Aspekte beleuchtet und technische Lösungen sowohl auf Flugzeug als auch auf Triebwerks- beziehungsweise Komponentenebene skizziert und diskutiert. Dabei sind insbesondere drei Betriebsarten von Interesse: 1. Wechselbetrieb, 2. Umschaltbetrieb und 3. Parallelbetrieb. Für jedes dieser Szenarien gibt es Vor- und Nachteile sowie technische Lösungen, die aus Sicht des Triebwerksherstellers Rolls-Royce in diesem Paper vorgestellt werden.
Zusammenfassung (EN):
Hydrogen plays a central role in the decarbonization of aviation as a potentially completely CO2-free alternative to Sustainable Aviation Fuels (SAF). However, numerous technical, logistical, and commercial challenges must be overcome before hydrogen can be introduced to the market. In the last three years, some of the technical challenges, such as the safe and clean direct combustion of hydrogen in an aircraft gas turbine, have already been successfully addressed [1-4]. However, the integration of a liquid hydrogen supply into the engine or airframe, in particular, has not yet reached an acceptable technological level; for example, the necessary pumps are not yet fully developed. Furthermore, the safe handling of liquid hydrogen in aircraft, and especially at airports, is not yet established. The necessary infrastructure worldwide for supplying airports with the required quantities will also not be universally available when the first hydrogen-powered aircraft is ready for market. Therefore, the question arises as to which model is commercially viable for introducing hydrogen into aviation. Based on the challenges mentioned above, it may be sensible to power short-haul aircraft with hydrogen, which could then be stored in gaseous form on board. For medium- and long-haul flights, Sustainable Aviation Fuel (SAF) would be used. However, a viable business case will only emerge if a sufficient number of aircraft can be brought to market. Therefore, it would make sense, particularly in the business travel and regional aircraft markets, to establish products that can operate on both fuels, as these often only serve short distances of up to 1000 nautical miles, but still need to offer customers a range of 4000 nautical miles or more. This is known as "dual-fuel" operation. This concept is being investigated by Rolls-Royce in the research projects Cavendish (EU Clean Aviation), Wotan (Lufo 6, grant number 20M2104A), and Bretuflex (Lufo 6, grant number 20M2237H). This paper examines the operational and technical aspects necessary for dual-fuel operation and outlines and discusses technical solutions at both the aircraft and engine/component levels. Three operating modes are of particular interest: 1. Dual-fuel operation, 2. Switchover operation, and 3. Parallel operation. Each of these scenarios has advantages and disadvantages, as well as technical solutions, which are presented in this paper from the perspective of the engine manufacturer Rolls-Royce.
Veranstaltung:
Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2025, Augsburg
Verlag, Ort:
Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt - Lilienthal-Oberth e.V., Bonn, 2025
Medientyp:
Conference Paper
Sprache:
deutsch
Format:
21,0 x 29,7 cm, 6 Seiten
URN:
urn:nbn:de:101:1-2511031343336.755283647142
DOI:
10.25967/650019
Stichworte zum Inhalt:
Wasserstoff, Fluggasturbine
Verfügbarkeit:
Download
- Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen dieses Dokuments: Copyright protected
Kommentar:
Zitierform:
Clemen, C.; Eggels, R.; Dörr, T. (2025): Verfahren und Technologien für einen kombinierten Wasserstoff-SAF-Betrieb von Regional- und Geschäftsreiseflugzeugen. Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt - Lilienthal-Oberth e.V.. (Text). https://doi.org/10.25967/650019. urn:nbn:de:101:1-2511031343336.755283647142.
Veröffentlicht am:
03.11.2025